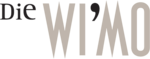Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz knüpft das Pilotprojekt „Nachkommen von NS-Verfolgten erzählen. Lernsettings und Lernmöglichkeiten an Schulen“ von ERINNERN.AT genau an diesem Gedenken an. Die Schüler*innen der 4CHW der WI’MO hatten die Möglichkeit, Teil dieses Projekts zu sein.
In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Tirol, der Universität Klagenfurt und der Universität Wien wurden im Unterricht Gespräche mit Nachkommen jüdischer NS-Verfolgter geführt und wissenschaftlich begleitet. Der Hintergrund dieses Projekts ist das nahende Abschiednehmen von den Zeitzeugen. Daher gewinnen Begegnungen und Gespräche mit Nachkommen der zweiten und dritten Generation zunehmend an Bedeutung.
Im Unterricht wurde das historische Kapitel zunächst theoretisch erarbeitet. Im Anschluss fand das Gespräch mit der Nachkommin Anna Goldenberg statt, begleitet von einer Vor- und Nachbesprechung mit der Lehrperson Prof. Silke Sallinger und dem Projektteam, um Eindrücke zu reflektieren und Beobachtungen auszutauschen.
Die Moderation des Gesprächs im Unterricht übernahm Nadja Danglmaier, die am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Klagenfurt tätig ist. Die Projektbeobachtung lag bei Amos Postner vom Institut für Bildungswissenschaft in Wien. Anna Goldenberg, Journalistin in Wien, erzählte als Nachkommin jüdischer NS-Verfolgter die bewegende Geschichte ihrer Familie.
Ihre Großmutter erlebte gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester die Deportation nach Theresienstadt, während ihr Großvater von seinem Schularzt versteckt wurde. Ihre Großmutter, die bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 2024 noch selbst Schulbesuche machte, und ihr Großvater, der 1996 verstarb, hinterließen ihrer Enkelin nicht nur viele Erzählungen, sondern auch Dokumente und Aufzeichnungen. Durch ihr persönliches Interesse entschloss sie sich, ein Buch – „Verstecke Jahre“ – über die Geschichte ihrer Großeltern zu schreiben.
„Ich möchte das weitertragen, was meiner Großmutter bis zuletzt wichtig war – deshalb besuche ich heute Schulen“, antwortete Anna Goldenberg auf die Frage „Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Geschichte Ihrer Großmutter in der Öffentlichkeit zu erzählen und was hat Sie dazu bewegt, in Schulen Vorträge über diese Zeit zu halten?“
Auf die Frage, ob sie selbst Jüdin sei und ob sie Antisemitismus erlebt habe, erklärte sie, was jüdisch sein für sie bedeutet und machte deutlich, dass Religion, Identität und Heimatgefühl zum Beispiel auch in ihrer Familie jede*r ganz anders auslebe. Des Weiteren erzählte sie, dass im Unterschied zu anderen Familien der Holocaust bei ihr zuhause kein Tabuthema war. Schon in ihrer Kindheit wurde offen darüber gesprochen: „Seit ich denken kann“, sagte sie, „war das Teil unserer Geschichte.“ Besonders eindrucksvoll war, dass Anna Goldenberg auch Familienfotos sowie den Ghetto-Ausweis ihrer Großmutter aus Theresienstadt mitbrachte, zu dem die Schüler*innen einige Nachfragen hatten.
Im Verlauf des Besuchs bekamen die Schüler*innen immer wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen, persönliche Fragen zu stellen und sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einige der Fragen, die sie an die Nachkommin richteten, lauteten:
- Wie bewerten Sie die jetzige politische Lage? Gehen davon wieder Gefahren aus?
- Hat Ihre Großmutter jemals an Flucht gedacht?
- Haben die Menschen an der Hoffnung, dass das alles irgendwann ein Ende nimmt festgehalten?
- Verspürte man gegen die Nationalsozialisten Hass, Enttäuschung oder welche Gefühle verspürte man solchen Personen gegenüber? Wie konnten Ihre Großeltern dieser Gesellschaft verzeihen?
- Haben Ihre Großeltern nach dem Krieg Hass oder Feindseligkeit gespürt? War der Hass gegen Juden nach dem Krieg weiterhin spürbar?
- Wie war die Situation nach dem Krieg, als ihre Großeltern nach Österreich zurückkehrten, hatten sie bestimmte Ängste/Sorgen und warum kehrten sie so schnell wieder aus den USA zurück?
- Haben jüdische Familien in den Jahren danach eine „Entschädigung“ bekommen?
- Wie haben die Menschen auf die Rücktransporte aus Auschwitz nach Theresienstadt nach dem Kriegsende reagiert? Wurden die Rückkehrer von den anderen Insassen unterstützt oder wurden sie nicht gut aufgenommen? Welche Hilfe erfolgte nach ihrer Ankunft?
- Wie überlebte der Vater Ihrer Großmutter in Auschwitz? Weiß man darüber etwas?

„Für die Schüler*innen war die Teilnahme an diesem Projekt eine wertvolle Erfahrung, die ihr historisches Bewusstsein vertiefte. Auch wenn Themen rund um den Nationalsozialismus im Unterricht behandelt werden, ist es für Schüler*innen etwas völlig anderes, wenn Menschen darüber sprechen, die einen direkten, familiären Bezug haben“, so Prof. Sallinger, die diese Projektinitiative begleitete.