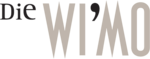Am 8. Mai wird alljährlich der Tag der Befreiung gefeiert. Dabei wird der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa sowie der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 78 Jahren gedacht. Auch an der WI’MO erhält dieser Tag die nötige Aufmerksamkeit, spielen Projekte zur Erinnerungskultur doch immer wieder eine große Rolle im Schulalltag.
Für den Jahresbericht, der Anfang Juli erscheinen wird, bat die WI’MO daher die Erziehungswissenschaftlerin Nadja Danglmaier, Leiterin des erinnern.at-Netzwerkes in Kärnten, zum Interview.
Welche Bedeutung spielen Erinnerungsorte in unserer Heimat für die Auseinandersetzung mit Geschichte?
Danglmaier: Sich mit Geschichte zu beschäftigen, die hier passiert ist, wo wir leben, arbeiten, lernen, unsere Freizeit genießen, … erreicht uns emotional ganz anders, als über historische Ereignisse von anderswo zu erfahren. Was hier – an den Orten, die uns vertraut sind – geschehen ist, ist für uns viel leichter nachvollziehbar, wir sehen etwas vor unserem geistigen Auge und die Fakten, von denen wir hören bleiben nicht nur in unserem Kopf, sondern erreichen auch das Herz.
Sie vermitteln verschiedenen Generationen Facetten unserer Geschichte. Wie setzen gerade sich junge Menschen mit unserem schwierigen historischen Erbe auseinander?
Danglmaier: Für die junge Generation von heute sind die Geschehnisse des NS-Regimes ewig weit entfernt, für viele war es die Zeit, als ihre Urgroßeltern Kinder waren. Diese Geschichte näher heranzuholen, gelingt nur, wenn wir sie über konkrete Menschen und ihre Biografien erzählen und wenn wir auch gemeinsam darüber nachdenken, was die Ereignisse von damals für unser heute bedeuten.
Stoßen Sie mit Ihren Themen auch heute gelegentlich noch auf Ablehnung?
Danglmaier: Oft wird die Frage gestellt: Warum noch immer darüber reden, daran erinnern? Dem kann ich als Pädagogin vieles entgegensetzen, weil es mir eben um Bildungsprozesse für eine gute Zukunft für alle geht, und die erreichen wir nur, wenn wir an den demokratischen Grundwerten arbeiten und uns Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen bewusst machen.
Bei Stadtspaziergängen ist es mir des Öfteren passiert, dass sich PassantInnen auf der Straße einmischen, das Gespräch zwischen mir und der Gruppe unterbrechen und lautstark kundtun, es solle endlich Schluss sein mit diesem Thema. Doch auch das Gegenteil habe ich erlebt: PassantInnen, die sich dazustellen und zuhören oder mitdiskutieren und sich interessiert zeigen.
Ist die Geschichte der Opfer des Nationalsozialismus jemals auserzählt? Die letzten Zeitzeugen verlassen uns sukzessive.
Danglmaier: Nicht solange es Diskriminierung und Ausgrenzung in tausenden Facetten und Ausprägungen, im Großen und im Kleinen, gibt. Nicht, solange es irgendwo auf der Welt Menschenrechtsverletzungen gib und nicht jeder Staat demokratisch ist. So lange haben wir genügend Gegenwartsbezüge, um die Geschichte weiterzuerzählen, auch wenn es ohne ZeitzeugInnen schwieriger wird.
Gab es Erlebnisse mit den Jugendlichen der WI’MO, die für Sie selbst prägend waren?
Danglmaier: In verschiedenen Gesprächen der SchülerInnen zu hören, dass sie überrascht waren, dass die Geschichte direkt vor ihrer Schultür stattgefunden hat und es direkt vor dem Schulhaus so viel zu erzählen gibt: von unterschiedlichen Opfergruppen, von TäterInnen und MitläuferInnen, vom Zuschauen und Widerstand leisten – Schultür auf und man steht mitten in einer historisch bedeutenden Zone. Diese Erkenntnis wirkt hoffentlich bei vielen noch nach.
* * *
Titelbild: Cover der Tageszeitung Neues Österreich vom 8. Mai 1945, abrufbar hier: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nos&datum=19450508&seite=1&zoom=33